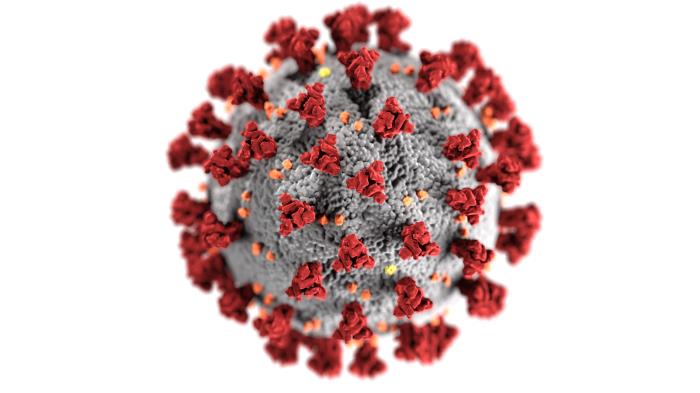Überzeugungskraft trotz Ungewissheit? Numerische Evidenzpraktiken für die Politik in der Coronakrise
Karin Zachmann, Professorin für Technikgeschichte TUM und Sprecherin der DFG FOR 2448 (Evidenzpraktiken in Wissenschaft, Medizin, Technik und Gesellschaft)
Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Die vier kantischen Fragen sind hochaktuell in der Coronapandemie, die Regierungen betroffener Länder – und das sind mittlerweile fast alle der Welt – vor weitreichende Entscheidungen stellt, in denen es in letzter Instanz um die conditio humana geht. Aber welche Maßnahmen sind als Reaktion auf die Coronapandemie angemessen in Anbetracht einer Gefahr, deren Ausmaß noch schwer abzuschätzen ist? Um das zu wissen gilt es, die Infektionskrankheit Corvid-19 und ihre Ausbreitungsdynamik zu verstehen. Die Expert*innen der Stunde sind zum einen die Virolog*innen, Epidemiolog*innen, Intensivmediziner*innen, Patholog*innen usw., also die Expert*innen der medizinischen Forschung und Praxis. Zum anderen sind es Expert*innen aus dem Bereich der Pandemieforschung, die ihre Verbreitungsdynamik erforschen und auf Wissensbestände und Methoden aus der Statistik, der Systemanalyse, der Verkehrsforschung, der Verhaltensforschung etc. zurückgreifen. In der öffentlichen Darstellung der Pandemie sind Statistiken und Modelle außerordentlich prominent. Und es ist zu beobachten, dass sich, je länger die Krise andauert und je mehr Länder sie erfasst, nach anfänglich sehr verschiedenen politischen Strategien nun der Lockdown des sozialen Lebens und Social Distancing in immer mehr Gesellschaften durchsetzt. Dabei wird, mit dem Ziel, Infektionsketten zu unterbrechen, tief in persönliche Freiheits- und demokratische Grundrechte der Bürger eingegriffen. Eine solche Politik aber ist in einer Demokratie, die sich über die Mitbestimmung der Bevölkerung definiert, in besonderem Maße begründungspflichtig, so dass sich die Frage stellt, auf welche Evidenz sich die Politiker berufen. Evidenz meint hier plausibles und überzeugendes Wissen, das eine breite gesellschaftliche Anerkennung erlangt hat, die in Aushandlungsprozessen entsteht. Im Rahmen dieser Wortmeldung wird gefragt, welche Formen von Evidenz in der Coronakrise aufgewertet werden, wer sie bereitstellt und was sie so überzeugend macht.
Quantitative Indikatoren für die Dimensionen der Pandemie
Konkrete Daten zum Infektionsgeschehen sind die Grundlage für die Gestaltung und Begründung von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Daten wie die Anzahl der Infizierten und Gestorbenen bilden das Rohmaterial, um die Ausbreitungsdynamik der Pandemie zu bestimmen und darzustellen. Als Maß für die Ausbreitungsdynamik hat sich die Verdopplungszeit der Infektionsfälle durchgesetzt, die wiederum von den Regierungen als Indikator für die Steuerung des Lockdowns installiert wurde. Die Fixierung auf eine konkrete Zahl, z.B. 10 Tage Verdopplungszeit als Indikator für ein Abflauen der Pandemie und eine Lockerung des Lockdowns, verleiht der Politik Autorität durch Klarheit, die als „Wahrheit“ erscheint. Die Auswirkungen der Pandemie werden im Moment vor allem in einer medizinischen Dimension, über die Letalitätsquote der neuen Infektionskrankheit, erfasst. Auch die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Pandemie sind in der öffentlichen Diskussion. Aber unter Verweis auf das Gebot ethischen Handelns werden Betrachtungen der ökonomischen, aber auch sozialen Folgen der Pandemie den medizinischen Perspektiven nachgeordnet. Und in der Tat ist für die Menschen (vor allem in den bisher besonders betroffenen Ländern des globalen Nordens) im 21. Jahrhundert die Erfahrung verstörend und bedrohlich, dass ein von Wildtieren auf den Menschen übertragenes Virus wie eine Naturkatastrophe über den ganzen Globus zieht und Menschenleben fordert, ohne dass rechtzeitig (Medizin-)Technik (Medikamente und Impfstoffe) vorhanden ist, um es aufzuhalten.
Infektionsfälle als unsichere Fakten
Dass im Kontext der außergewöhnlichen Krisensituation quantitative Evidenzpraktiken so stark hervortreten, wirft die Frage nach den Gründen dafür auf. Die Infektionsstatistik mit ihren Tabellen und Graphen stellt die Krankheit und ihre Verbreitung mittels der numerischen Sprache dar. Aber hinter den konkreten Zahlenangaben für Infektionsfälle und den auf dieser Grundlage berechneten Werten zur Entwicklung der Pandemie verbergen sich nicht unbeträchtliche Unsicherheiten. Und die werden, im Unterschied zum medizinischen Diskurs über die Pandemie, weit weniger offensiv diskutiert. Die Daten, die der Infektionsstatistik zugrunde liegen, repräsentieren keineswegs harte und eindeutige Fakten. Das zeigt sich auf einer ersten Ebene schon an den verschiedenen Erfassungsmöglichkeiten von Infizierten. Ob nur positiv getestete Personen oder auch hospitalisierte Personen mit Symptomen aber ohne Test in die Statistik eingehen, das macht einen Unterschied. Wie werden nicht getestete Personen mit leichten Symptomen erfasst und was ist mit all jenen, die infiziert sind, aber keine Symptome zeigen? Diese Unklarheiten werden mit Verweis auf eine „Dunkelziffer“ benannt, deren Abschätzung aber in einer großen Bandbreite, vom Fünf- bis zum Zwanzigfachen der erfassten Infektionsfälle variiert. Wenn aber die Konventionen der Messung differieren, dann sinkt die Genauigkeit der Daten. Das gilt besonders, wenn die Daten aggregiert und verglichen werden und Grundlage für Berechnungen sind.
Darstellungsformen und Aktualität als Konkurrenzvorteile in der Evidenzvermittlung
Die zurzeit in den Medien am häufigsten zitierte Statistik beruht auf den Daten, Tabellen und Graphiken des Teams um die Pandemieforscherin Lauren Gardner im Bereich Bauingenieurwesen und Systemanalyse der Johns-Hopkins-Universität. Lauren Gardner hat mit zwei Doktoranden ein Onlinetool entwickelt, das Daten von internationalen, nationalen, regionalen und städtischen Gesundheitsbehörden, aber auch Social Media und anderen Quellen erfasst, mehrfach täglich aktualisiert und graphisch aufbereitet. Damit wird versprochen, dass der dynamische Prozess der Pandemieausbreitung hier in Fast-Echtzeit dargestellt und verfolgt werden kann. Das wiederum ist von höchster Bedeutsamkeit in unserer durch das Internet grundlegend geprägten, kompetitiven Medienkultur, in der die Aktualität von Nachrichten zu einem erstrangigen Attraktionsfaktor geworden ist. Die zugunsten des Aktualitätsvorteils und der globalen Übersicht und Vergleichbarkeit in Kauf genommenen Kompromisse werden jedoch noch selten thematisiert. So ist keineswegs eindeutig und klar, wie von den unterschiedlichen Behörden und Akteuren, die das Team der Johns-Hopkins-Universität als Quellen anzapft, die Anzahl der Infizierten Personen gemessen wird. Außerdem sind die Erfassungszeitpunkte sehr verschieden und das relativiert einerseits das Aktualitätsargument und andererseits die Vergleichbarkeit der Länderstatistiken. Der Vergleich aber ist eine zentrale Methode für die Interpretation der Zahlen und er ist insbesondere für das Verständnis der Coronapandemie von großer Bedeutung, sowohl für die Pandemieforscher, aber auch in der Kommunikation über die Pandemie mit der Öffentlichkeit. Dass, wie Bettina Heintz herausgestellt hat, Vergleiche ein konstitutives Element sozialer Ordnung sind, gilt auch in der globalen Coronakrise. Der Vergleich von Infektionsfällen oder Sterberaten für verschiedene Länder vermittelt nicht nur Informationen über die Ausbreitungsdynamik der Pandemie und ihren Verlauf, sondern bewertet und positioniert nationale Gesundheitssysteme und damit letztlich auch die Performanz nationaler Regierungen. Dabei wird der Vergleich auch politisch instrumentalisiert und von Populisten und Autokraten für machtpolitische Muskelspiele missbraucht, zumindest solange sie von der Dynamik der Pandemie noch nicht überrollt werden. Ein beredtes Beispiel dafür war der Kurswechsel Trumps in der Pandemiepolitik.
Große Unterschiede in den Sterberaten als statistische Fiktion?
Die Ungenauigkeiten der Infektionsdaten beeinflussen grundlegende Einschätzungen der Pandemie, zum Beispiel ihre Letalitätsraten. John Lee, ein emeritierter Pathologe und Berater des National Health Service im UK nimmt die starke Differenz der Sterblichkeit durch Corvid-19 in Ländern mit sehr ähnlichen Lebensbedingungen und vergleichbarer Wirtschaftskraft nicht als sicheres Faktum, sondern führt sie auf unterschiedliche Konventionen in der Sterbestatistik und Unterschiede in den Bezugsgrößen zurück. Lee betont, dass es keinen internationalen Standard zur Beschreibung von Todesursachen gibt. Zudem werden überall dort, wo das Gesundheitssystem an Grenzen kommt und die Kapazitäten zum Testen nicht ausreichen nicht nur Tote DURCH, sondern auch Tote MIT Corvid-19 als Opfer der Pandemie gezählt. Die Unterschätzung von Infektionszahlen erhöht die Letalitätsrate ebenfalls. Die in der Statistik der Johns-Hopkins-Universität, aber auch in nationalen Statistiken gemessenen Todeszahlen sind also aus doppeltem Grund, der Konvention der Messung und der Bezugsgröße, nur sehr bedingt geeignet, die Letalitätsquote der Coronapandemie ausreichend genau zu bestimmen.
All das verweist auf große Unsicherheiten in der Infektionsstatistik. Aber diese werden durch die fallkonkreten Zahlenangaben verdeckt, anders als beispielsweise im medizinischen Diskurs über die neue Krankheit, in dem die Grenzen des Wissens sehr präsent sind. Die Community der Statistiker geht im Fachdiskurs grundsätzlich ganz offensiv mit solchen Unsicherheiten um, indem sie diese diskutiert und Fehlerabschätzungen durchführt. Aber bei der Rezeption von Statistiken durch ein Laienpublikum wird die Fehlerdiskussion übersehen oder nicht mittransportiert, teilweise auch von den Statistikern selbst ausgeklammert, als für die Laien zu kompliziert. So hat Gardner bei der Vorstellung ihres Dashboards vor einem Ausschuss im US Kongress den wissenschaftlichen Apparat (Quellen- und Berechnungsverweise und Diskussion) nur ganz kurz gezeigt und gleich wieder ausgeblendet mit dem Vermerk, dass das ohnehin niemand lesen würde.
Die rhetorische Macht der numerischen Sprache
Ist es nicht erstaunlich, dass unsicheres Wissen eine so große Überzeugungskraft erlangt, dass die Regierungen Maßnahmen damit begründen können, die das Leben der Menschen sehr grundlegend reglementieren und beschränken? Freilich, die Regierungen stehen in dieser außergewöhnlichen Krise unter einem hohen Handlungsdruck und sind angewiesen auf die Wissenschaft, deren Ergebnisse selten eindeutig und meist vorläufig sind. Aber was verleiht gerade den Zahlen eine so große Plausibilität, dass sie trotz aller Einschränkungen zu starker Evidenz für die Darstellung und Bearbeitung der Coronakrise für Politik und Öffentlichkeit geworden sind? Eine überzeugende Begründung dafür lässt sich aus der von Bettina Heintz entwickelten These zur „numerischen Differenz“ ableiten.
Dass Zahlen besser zirkulieren als Worte erklärt Heintz anhand von vier Merkmalen der numerischen Sprache. Das sind erstens ihre Erzeugungsregeln. Sie ist unter der Voraussetzung von Zahlen- und Rechenkompetenz in hohem Maße selbstexplikativ und nicht auf externe Kommentare angewiesen. Zugleich unterbindet die hochgradige Normierung der numerischen Sprache Kontingenz und erleichtert damit die Rezeption. Als zweites Merkmal wird Selbstreferentialität genannt. Die Grundkategorien der Mathematik sind innermathematisch begründet und Zahlen werden intern bestätigt, wenn sie nur noch mit anderen Zahlen ins Verhältnis gesetzt werden. Damit sind Zahlen aber auch ein ideales Medium für den Vergleich. Drittens ist die numerische Sprache praktisch universell, muss nicht übersetzt werden und ist so anschlussfähig in ganz unterschiedlichen kulturellen Kontexten. Mithin erleichtert die numerische Sprache Verständigungen über international ablaufende Prozesse, wie eben auch eine Pandemie. Kommunikation über numerische Sprache ist per se intersubjektiv, während interlinguale Kommunikation wegen der Polysemie der Sprachen nur einen pragmatischen und nie einen umfassenden Konsens ermöglicht. Viertens präsentieren sich die strikt regelgebundenen Verfahren der Mathematik als logisch stringent und überzeugend. So sind auch die über die Berechnung der Verdopplungszeit von Infektionsfällen bestimmten numerischen Aussagen zur Ausbreitungsdynamik der Pandemie sehr einleuchtend und glaubwürdig.
Diese besonderen Eigenschaften der numerischen Sprache verleihen also den mit ihr vorgebrachten Argumenten eine große kulturelle Anschlussfähigkeit. Plausibilität und Glaubwürdigkeit von Wissen als Evidenz zur Begründung der tiefgreifenden gesellschaftlichen Eingriffe im Namen der Pandemiepolitik speist sich also in einem gewissen Maße auch aus dieser soziokulturellen Dimension. Die Tabellen und Graphiken der Infektionsstatistik haben eine starke rhetorische Funktion. Es geht nicht in erster Linie darum, die „Wahrheit“ zu beweisen, sondern in einer Situation großer Ungewissheit Entscheidungen zu treffen und zu begründen, die plausibel sind. Im Moment materialisiert sich die Überzeugungskraft der Infektionsstatistiken darin, dass immer mehr Regierungen auf die Politik des Lockdowns und Social Distancing eingeschwenkt sind.